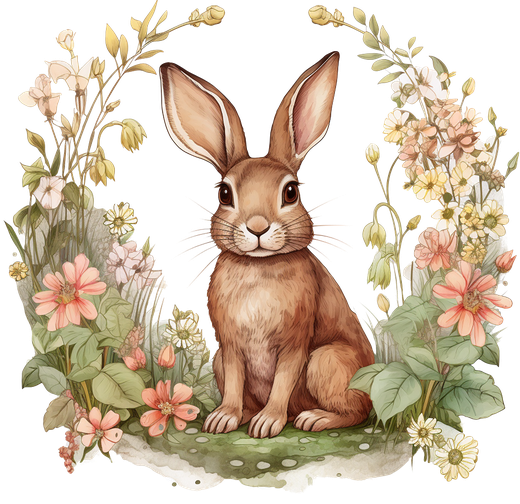
Eins, zwei, Osterei
Was hat Ostern mit der Sprachentwicklung von Kindern zu tun? Ich vergleiche die Sprachentwicklung von Kindern gerne mit der Osterzeit. Denn so wie das Wunder der Natur im Frühling jedes Jahr ohne Mühe alles zum Wachsen und Gedeihen bringt, so lernen die meisten Kinder in den ersten Lebensjahren mühelos das komplexeste Kommunikationssystem des bekannten Universums. Das Erlernen der Sprache ist eine geistige Höchstleistung, die bis heute noch nicht komplett verstanden ist. Kleinkinder eignen sich Sprache und das Sprechen nach eigenen Regeln an, die anders sind, als wir sie in der Schule lernen. Wie schnell sich ein Kind Sprache aneignet, ist recht unterschiedlich.
Trotzdem ist heute unbestritten, dass der Erwerb gewisser Fähigkeiten vom Sehen über Hören und Sprechen bis zur Bewegung an Entwicklungsfenster gebunden ist, in denen die richtigen Reize bzw. Stimulierungen aus der Umwelt kommen müssen.
Die Osterwunder der kindlichen Entwicklung
Sehen wir uns ein paar dieser Osterwunder der Entwicklung einmal an:
Schon zwischen dem 1 und 3 Monat lauschen Babys auf einen Glockenton oder eine Stimme. Mit 4 Monaten erkennt das Baby die Stimme der Bezugsperson, mit 6 Monaten sagt es «mama», «baba» und «dada» ohne Bedeutung. Mama und Papa mit Bedeutung sagt es ab 11 Monaten, ab 15 Monaten sagt es 3 Worte ausser Mama und Papa und ab 18 Monaten kombiniert es bereits 2 Worte und zeigt auf Verlangen auf ein Körperteil. Es gibt allerdings teils erhebliche Unterschiede in der Entwicklung. Manche Kinder sprechen bereits mit 9 Monaten ihr erstes Wort, einige lassen sich aber auch bis zum Alter von 2,5 Jahren Zeit. Auch beim Wortschatz liegt bei 20 Monate alten Kindern die Spanne der erlernten Wörter zwischen 50 und 200 Wörtern.
Magisch wie der Osterhase
Ebenso zauberhaft und magisch wie der Glaube an den Osterhasen sind die Regeln der Sprachaneignung bei Kindern. Kinder lernen Sprache und Sprechen nach eigenen Regeln und anders als Erwachsene. Sie eignen sich nach und nach die Sprache an, die sie in ihrer nächsten Umgebung hören, ihre Mutter- oder Erstsprache. Und sie tun dies aus ihren täglichen Erfahrungen heraus, aus dem, was sie hören, sehen, fühlen und tun. Gerade innerhalb der ersten Jahre wird daher die Basis für ein erfolgreiches Schul- und später auch Berufsleben geschaffen. Da die Sprachlernfähigkeit sich so früh entwickelt, könnte Bildung in diesem Bereich deutlich früher beginnen, als dies bei uns in der Schweiz praktiziert wird. Die Entwicklungsfenster für das mühelose Erlernen einer Sprache nach dem System von Kleinkindern, ist daher im Alter von 8 Jahren, also dem Alter, ab dem die erste Fremdsprache in der Schule erlernt wird, bereits wieder geschlossen. Das erklärt auch, weshalb Kinder sich durchaus nicht alle mit dem Fremdsprachenlernen so leichttun. Die Idee von Frühenglisch und Frühfranzösisch ist zwar grundsätzlich begrüssenswert, aber da in der Schweiz so spät eingeschult wird, bringt sie nicht den erwünschten Erfolg. Stattdessen überfordert sie viele Kinder, die z.B. bereits in der Erstsprache Mühe bekunden.
Wie findet man die Ostereier?
Helfen Sie Ihrem Kind beim Entdecken der Sprache. Dem obigen Gedanken folgend sollten Sprach- und Lernunterschiede schon vor dem Schulbeginn möglichst gering sein, damit alle Kinder auf einer stabilen Basis in die Schule eintreten können. Bereits das Baby kann in seiner sprachlichen Entwicklung unterstützt werden, indem seine Freude am Sprechen geweckt wird. Ein langsames, vereinfachtes, sich wiederholendes und ausdrucksstarkes Sprechen entspricht zum Beispiel dem, was ein Baby aufnehmen kann. Im Kleinkindalter sollte jedoch nicht mehr in „Babysprache“ mit dem Kind geredet werden. Bei fremdsprachigen Kindern sollte nicht der Fehler begangen werden, dass sich Eltern möglichst früh der hiesigen Landessprache anpassen. Dieses Vorgehen bringt leider nicht den erwünschten Nutzen. Stattdessen machen sich spätestens ab der 5 und 6 Klasse Wortschatzlücken bemerkbar. Denn nur in der Erstsprache kann die Wortschatzmenge vermittelt werden, die der Komplexität von Sprache wirklich entspricht. Deshalb sollten fremdsprachige Eltern darauf vertrauen, dass ihr Kind in der Spielgruppe und im Kindergarten die Landessprache lernt und stattdessen sich darum bemühen, den Kindern die Muttersprache möglichst korrekt und wortschatzreich beizubringen. Die wichtigste Aktivität ist dabei das Vorlesen in der Muttersprache und das gemeinsame Singen von traditionellem Liedgut. Unterschiede im Engagement der Eltern, ihren Kindern die Muttersprache zu vermitteln, prägen die Kinder bis zum zweiten Lebensjahr und können nur schwer wieder ausgeglichen werden.
So erblüht die Wortschatzwiese
Auf die richtigen Bedingungen kommt es nicht nur beim Wachstum in der Natur an. Auch für die Sprachentwicklung von Kindern müssen die richtigen Samen auf fruchtbaren Boden fallen. In einigen Ländern sind die Konzepte für frühkindliche Förderung sehr weit entwickelt. Vorreiter sind in diesem Bereich die Beneluxstaaten und der skandinavische Raum, aber auch Grossbritannien hat mit den sogenannten «Children Centres» stark aufgeholt. Alle Entwicklungsstufen von Kleinkindern und die dadurch anfallenden Alltagsaufgaben werden methodisch aufgearbeitet. Damit einher gehen auch die Ausbildung und Weiterbildung der Betreuer sowie das Ableiten von Bildungsangeboten im Bereich der Frühförderung. Die Neigung im deutschsprachigen Raum, eine verspielte, möglichst lang dauernde Kindlichkeit als Voraussetzung einer glücklichen Kindheit zu interpretieren, entspringt der Vorstellung, dass Schulen eine disziplinierende Belastung bringen und den Kindern möglichst lange erspart bleiben sollten. Diese Vorstellung ist nicht haltbar, da gerade kleine Kinder neugierig sind und einen natürlichen Lerndrang haben. Es kommt darauf an, ihrer natürlichen Lernbereitschaft entgegenzukommen, ohne sie zu überfordern. Kindertagesstätten, Kindergärten und Schulen sollten daher langfristig eine aufeinander bezogene Organisation bilden, wo Lernen mit Freude stattfindet und eine gute Basis dafür geschaffen wird, dass Kinder beim Schuleintritt sprachlich möglichst auf gleichem Niveau sind. Die Anstrengungen in die vorschulische Sprachförderung müssen unbedingt intensiviert werden.




Kommentar schreiben